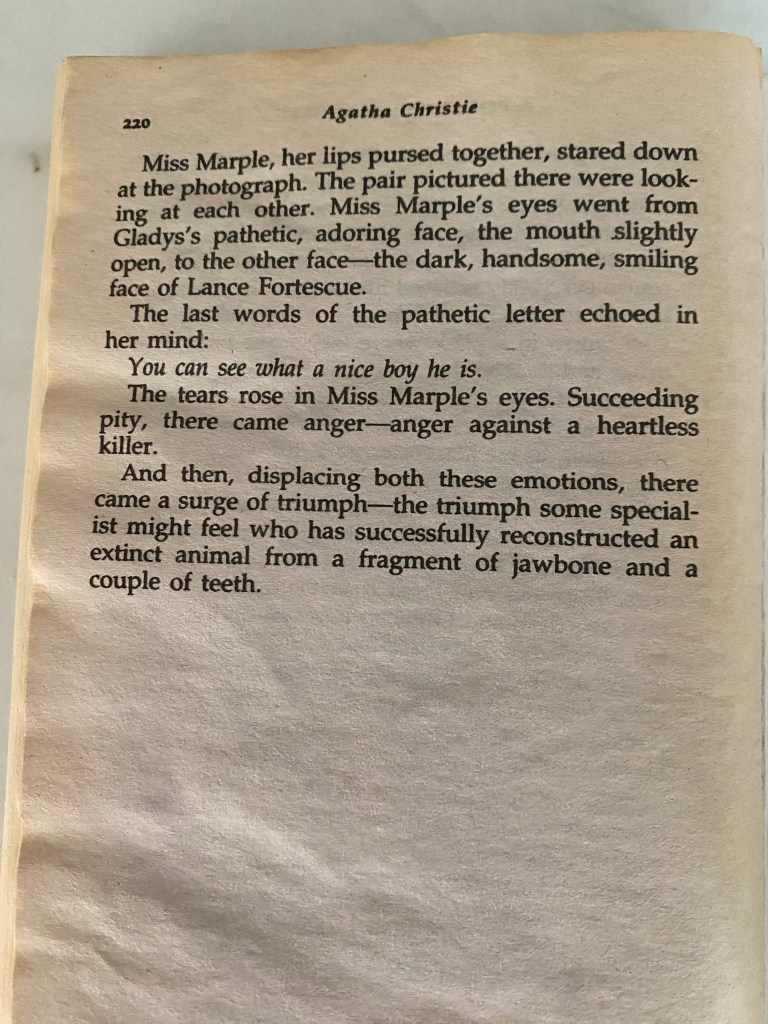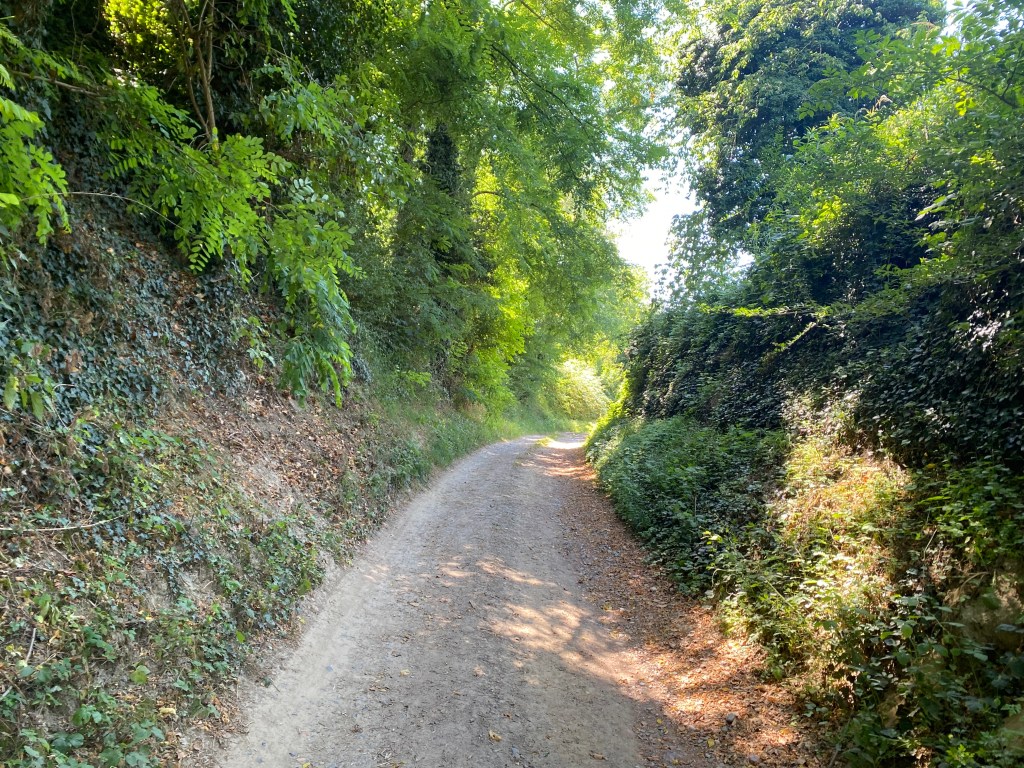Ich habe mir vorgestellt, eigentlich um mich nochmal in den Schlaf zu denken, wie ich mit einem durchaus sympathischen Politiker ein bestimmtes Thema diskutiere. Dabei ging mir glasklar auf, dass dieses Gespräch dort Grenzen haben würde, wo seine Politikereigenschaft nicht mehr alles abdecken kann, wo er an die Ränder seiner abgesteckten Welt käme.
Am einfachsten stellt ihr euch das vor, wenn ihr an den Versuch denkt, mit einem religiösen Menschen zu diskutieren. Der kann lustig sein und klug, freundlich und unkonventionell, bis zu einem gewissen Punkt. Wo der Glaube ins Spiel kommt, wird der selbe Mensch hart, kalt oder hitzig, gemein, wütend und gewaltbereit. Und wie dieser religiöse Glaube, der auch nur die Vermutung, jenseits seiner Grenzen könne noch, könne auch etwas sein, könne Gutes, Richtiges, Wichtiges oder auch nur Mögliches sein, nicht zulässt, so wirken auch bewusst oder unbewusst akzeptierte Definitionen wie „man“ ist, wie „die Welt“ ist. Alleine die gedankliche Nähe zu diesen Grenzen löst in den Betroffenen solche Angst aus, dass sie alles tun würden, um nur nicht über diese Grenzen hinausdenken zu müssen. Weder mit Logik noch mit Liebe kommt man weiter.
Es kann auch ein Beruf sein, der allgemein auf eine bestimmte Art bewertet ist (lasst mal einige Beispiele in euch anklingen). Geraten wir nun in so ein Berufsfeld, besteht die Gefahr, dass wir diese Zuschreibungen auf unser Tun und Denken übergreifen lassen und uns so verhalten wie es in unserer Natur nicht angelegt ist. Es kann eine Eigenschaft sein, die du hast, mit der die anderen um dich herum bestimmte weitere Eigenschaften verbinden und sie dir so selbstverständlich zuschreiben, dass du dich unbewusst verpflichtet fühlst, sie zu entwickeln oder wenigstens zu zeigen oder in Verzweiflung gerätst, weil du permanent falsch eingeschätzt wirst. Es kann auch eine Gruppe sein, eine Schulklasse, eine Clique, eine Interessengemeinschaft, ein Verein, was auch immer.
Geraten wir dort hinein, weil wir zugeteilt werden wie in eine Schulklasse, uns für einen Beruf oder auch nur einen Job entschieden haben oder weil wir die Begeisterung für ein bestimmtes Thema teilen, laufen wir direkt Gefahr, uns den anderen, dieser Gruppe allgemein zugeschriebenen Eigenschaften und Verhaltensweisen anpassen zu wollen, um dazuzugehören.* Da wir diese Regeln aber nicht verstehen oder ihren Sinn nicht erkennen, wahrscheinlich weil für uns gar keiner da ist, müssen wir uns verstellen, schauspielern und können das nicht lange überzeugend aufrechterhalten, gelten rasch als seltsam, komisch, nicht ganz richtig. Wir ahmen vielleicht nach, was die anderen tun, haben aber keine Ahnung, warum sie es tun und wirken unecht oder steigen von einem Fettnapf in den nächsten.
Selbst wenn wir überzeugend schauspielern, bleibt in uns selbst das schale Gefühl, irgendwelche sinnlosen Gesten zu machen, bei mir heißt dieses Gefühl „Kinderpost spielen“ und ist ein deutliches Zeichen, dass ich mich sammeln muss. Ebenso ist ein flatterndes Panikgefühl ohne Grund ein Zeichen, das Gefühl, jederzeit etwas Schreckliches anrichten zu können, weil eine Regel, die allen anderen selbstverständlich ist und die einem deswegen auch nie erklärt wird, nicht erkannt wird. Dann ist die Gefahr sich zu verlieren groß und es besteht die Not-Wendigkeit, sich wieder einzusammeln.
Womit sammle ich mich? Mit Be-Sinn-ung. Schauen, was meine Sinne machen, sie wieder aktivieren, unter der eben beschriebenen Anspannung fallen sie leicht aus, versuchen, einen Sinn zu erkennen (oder einen UNsinn zu entlarven, der kein lustiger Unfug ist sondern etwas, das sich gegen den biologischen Sinn, gegen das Lebendige Sein richtet).
Unglaublich hilfreich ist die von Ute Schiran beschriebene Grundhaltung, das wache Sein in der Kunst der Wiederholung (als tätest du alles zum ersten Mal), der Absichtslosigkeit (lass dir keinen Zweck vorschreiben), der Entschiedenheit (immerwährende Bekräftigung des Wunsches nach Lebendigkeit) und Aufmerksamkeit (KOREspondenzbereitschaft des Körpers, von innen her da, kein Radar, dass das Außen abtastet). Hilfreich ist Lebenserfahrung, eindeutig. Hilfreich wären Eltern, die das durchschaut haben. Hilfreich ist es, sich immer wieder auf anderes einzulassen, sich dem Lebendigen zu zeigen, zu spüren, welches Gefühl Situationen, Handlungen und Regeln hinter unserem Brustbein auslösen, was das Zwerchfell dazu sagt, wie unser Atem fließt. Hilfreich ist es, sich auf Botschaften einzulassen, die wir von allem um uns herum empfangen: Was sagen mir die Tiere und Pflanzen, denen ich begegne, was der Wind? Hilfreich sind Menschen, die uns sehen, ohne uns mit Etiketten zu ver-sehen.
Es gibt eine Ballade, die lang vergessen und heute schwer zu finden ist, wahrscheinlich weil sie sehr genau den Punkt trifft, vor dem alle Systeme, die uns mit Regeln und angeblichem Sinn in Angst und Gehorsam halten wollen, sich fürchten, eine Ballade von Robert Hamerling (1830 – 1889) mit dem Titel „Sankt Basilius in der Hölle“. Weil sie mir in diesem Zusammenhang wieder eingefallen ist, schreibe ich sie hier auf:
Sankt Basilius in der Hölle
von Robert Hamerling
Es war ein heiliger Mann, der tat
In seinen Werken den Christenrat,
Doch gegen das strenge Kirchenrecht
Verhielt er sich nicht ganz gerecht.
Man sprach den Bann über ihn und fort,
Verstoßen war er von Gottes Ort;
Die Pforte des Himmels blieb ihm zu,
Da sank er hinunter zur Hölle im Nu.
Doch siehe, die Flammen erbleichten sogleich,
Es wurde die Hölle öd und bleich;
Denn wo der Heilige nur erschien,
Da mussten die Gluten erlöschen hin.
Da riefen die Teufel: „Was sollen wir
Mit einem solchen Gesellen hier?
Er stört uns das Feuer, er kühlt uns die Glut,
Fort mit dem Heiligen, uns ist er nicht gut!“
Und sie warfen ihn wieder zur Erde hinaus,
Da stand er verlassen vor seinem Haus;
Da kam ein Engel und führte ihn still
Dorthin, wohin er nun kommen will.
Und siehe, die Himmel taten sich auf,
Es endete seltsam des Heiligen Lauf,
Denn — „wer in sich einen Himmel trägt
Und um sich schafft ein Paradies,
Den kann der Bann nicht bannen mehr,
Er ist des ew’gen Friedens wert.“
*(das Körperbewusstsein, im HUNA Ku, wird es auf jeden Fall versuchen, wenn Lono (Verstand) und Kane (höheres Selbst) nicht lenkend einwirken)